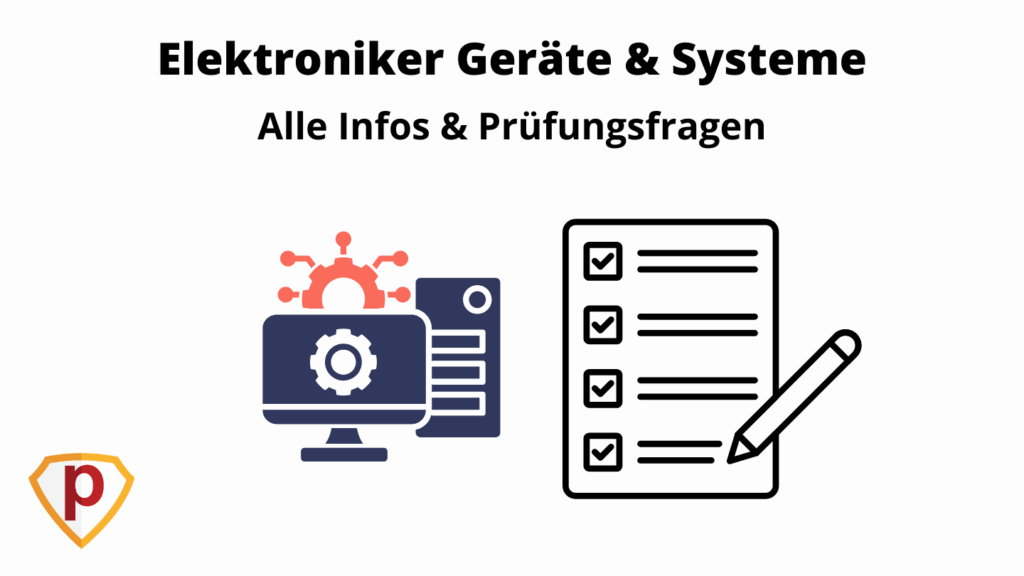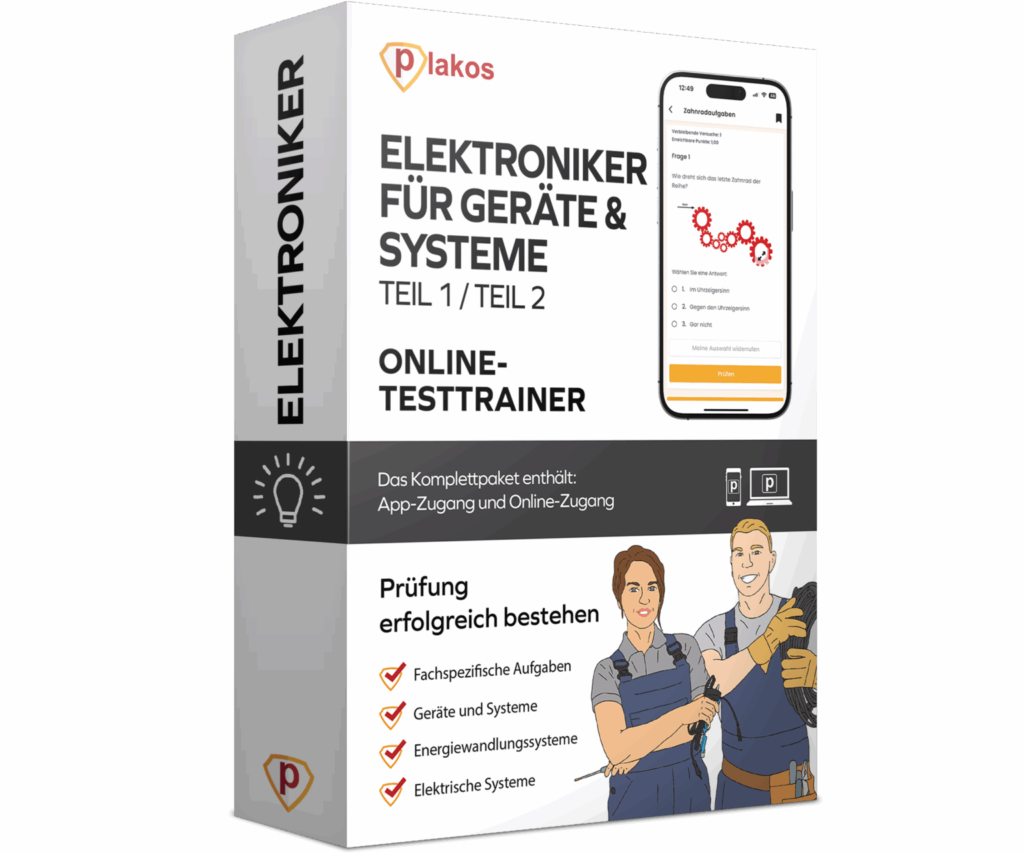Die Abschlussprüfung für Elektronikerinnen und Elektroniker für Geräte und Systeme ist ein wichtiger Meilenstein zum Ende der Ausbildung. Sie besteht aus zwei Teilen und prüft sowohl theoretisches als auch praktisches Fachwissen.
In diesem Beitrag erfährst du, was genau in Teil 1 und Teil 2 der Prüfung auf dich zukommt, welche typischen Aufgabenstellungen vorkommen und bekommst am Ende drei Beispielaufgaben mit Lösungen.

Aufbau der Abschlussprüfung
Die Elektroniker Prüfung ist gestreckt und unterteilt sich in Teil 1 und Teil 2.
Teil 1 findet in der Regel gegen Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt. Dabei handelt es sich um eine praktische Arbeitsaufgabe mit ergänzenden schriftlichen Fragen. Diese Zwischenprüfung zählt bereits anteilig zur Endnote. Der Schwerpunkt liegt auf grundlegenden beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du in der ersten Ausbildungshälfte erlernt hast.
Teil 2 folgt am Ende der Ausbildung und umfasst einen deutlich umfangreicheren Prüfungsbereich. Er besteht aus einem praktischen Arbeitsauftrag mit anschließendem Fachgespräch sowie drei schriftlichen Prüfungsbereichen: Systementwurf, Funktions- und Systemanalyse und Wirtschafts- und Sozialkunde.
Teil 1 der Prüfung: Grundlagen anwenden
Im ersten Teil der Prüfung bearbeitest du eine typische Arbeitsaufgabe aus deinem Berufsfeld. Diese umfasst meist eine technische Baugruppe oder ein Gerät, das du nach Vorgabe zusammenbauen, in Betrieb nehmen und prüfen sollst. Dazu kommen kleinere Messaufgaben oder die Fehlersuche.
Die Aufgabe wird schriftlich ergänzt – zum Beispiel durch Fragen zur Funktionsweise einzelner Bauteile oder durch einfache Berechnungen. Der Schwierigkeitsgrad ist überschaubar, da hier vor allem geprüft wird, ob du die Grundlagen der Elektrotechnik und Gerätemontage verstanden hast.
Teil 2 der Prüfung: Fachliches Können unter Beweis stellen
Der zweite Prüfungsteil bildet den Abschluss deiner Ausbildung. Er hat mehr Gewicht bei der Gesamtnote und ist deutlich umfassender.
Ein zentraler Bestandteil ist der sogenannte Arbeitsauftrag. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das entweder aus deinem Ausbildungsbetrieb stammt (betriebliches Projekt) oder von der prüfenden Stelle vorgegeben wird. Die Aufgabe ist praxisnah und umfasst häufig das Planen, Aufbauen, Programmieren und Prüfen eines Gerätes oder Systems. Typisch sind auch Messungen, Funktionstests oder kleinere Reparaturen.
Nach Abschluss des Arbeitsauftrags präsentierst du dein Vorgehen in einem Fachgespräch vor der Prüfungskommission. Dabei erklärst du technische Hintergründe, Entscheidungen und gegebenenfalls auftretende Probleme.
Zusätzlich nimmst du an drei schriftlichen Prüfungen teil:
- Systementwurf: Hier geht es um das Planen technischer Systeme, das Auswählen geeigneter Bauteile und das Verstehen von Schaltplänen. Häufig musst du selbst Schaltungen entwerfen oder technische Abläufe bewerten.
- Funktions- und Systemanalyse: In diesem Prüfungsteil wird dein Verständnis für den Betrieb technischer Geräte geprüft. Dazu zählen beispielsweise Fehlersuche, Signalverarbeitung oder das Verhalten von Bauteilen in bestimmten Situationen.
- Wirtschafts- und Sozialkunde (WiSo): In diesem Prüfungsteil geht es um Themen wie Rechte und Pflichten im Ausbildungsverhältnis, Arbeitsrecht, Umweltschutz und wirtschaftliche Zusammenhänge.
Typische Aufgabenstellungen
Die Prüfungsaufgaben orientieren sich stark an der betrieblichen Praxis. Typische Inhalte sind:
- Lesen und Umsetzen von Schaltplänen
- Aufbau und Verdrahtung elektronischer Baugruppen
- Durchführung von Messungen (z. B. Spannungen, Ströme, Widerstände)
- Programmierung oder Parametrierung von Mikrocontrollern
- Fehlersuche und Reparatur an elektronischen Geräten
- Dokumentation und Präsentation von Arbeitsabläufen
- Beantwortung technischer Verständnisfragen in schriftlicher Form
Drei Beispielaufgaben mit Lösungen
Im Folgenden stellen wir dir drei verschiedenen Prüfungsfragen vor, wie sie in der Elektroniker für Geräte und Systeme Prüfung drankommen könnten.
Beispiel 1:
Eine LED mit einer Flussspannung von 2 Volt soll an einer 12-Volt-Spannungsquelle betrieben werden. Der Strom soll 10 Milliampere betragen. Welcher Vorwiderstand wird benötigt?
Richtige Antwort
Lösung:
Spannungsabfall: 12 V – 2 V = 10 V
Strom: 0,01 A
R = U / I = 10 V / 0,01 A = 1000 Ohm
Beispiel 2:
Nenne jeweils ein aktives und ein passives elektronisches Bauelement und beschreibe den Unterschied.
Richtige Antwort
Lösung:
Aktives Bauelement: Transistor (kann Signale verstärken)
Passives Bauelement: Widerstand (verbraucht Energie, ohne Verstärkung)
Unterschied: Aktive Bauelemente benötigen eine externe Energiequelle, um ihre Funktion zu erfüllen.
Beispiel 3:
Was bedeutet die Abkürzung ESD und warum ist sie im Umgang mit elektronischen Bauteilen relevant?
Richtige Antwort
Lösung:
ESD steht für Electrostatic Discharge (elektrostatische Entladung).
Solche Entladungen können empfindliche Bauteile beschädigen. Deshalb müssen Elektroniker Maßnahmen wie ESD-Armbänder oder geerdete Arbeitsplätze einsetzen.
Fazit
Die Abschlussprüfung für Elektroniker für Geräte und Systeme erfordert technisches Verständnis, praktische Fertigkeiten und strukturiertes Arbeiten. Teil 1 prüft Grundlagen und handwerkliches Können, Teil 2 verlangt ein hohes Maß an Fachkompetenz, Eigenständigkeit und Planung. Wenn du dich gut mit den Inhalten deiner Ausbildung beschäftigst, praktische Aufgaben regelmäßig übst und die Prüfungssituation realistisch simulierst, bist du bestens vorbereitet. Die Prüfungsaufgaben sind anspruchsvoll, aber lösbar – mit der richtigen Vorbereitung steht deinem erfolgreichen Abschluss nichts im Weg.